Wie überlebt man eigentlich eine schwere Depression? Wie schafft man es trotz Traumata und Krebserkrankungen zurück ins Leben? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Jasmin Faust.
Meine wunderbare Freundin Jasmin Faust bloggt unter „How to get lost“ über ihre Depression und war in Folge 17 schon einmal Gast im „Mensch, Frau Nora!“ Podcast. Das ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Dazwischen zwei Jahre Corona und eine weitere Krebserkrankung bei Jasmin. Und trotzdem sitzt mir ein anderer Mensch gegenüber. Also nicht komplett anders, aber doch auch.
Wir wollen diesmal darüber sprechen, was sich für Jasmin in der Zeit verändert hat. Wie sie es geschafft hat, einen Umgang mit ihren Traumata zu finden, über Medikamente, Therapie und neuen Lebensmut. Über ein Leben mit Depressionen. Und das schönste: Trotz der Tiefe und Schwere dieses Gesprächs ist es diesmal von viel mehr Leichtigkeit getragen.
Wer Jasmin Faust heute kennenlernt, erlebt eine schlagfertige, intelligente und attraktive Mittvierziegerin. Auf die Idee, dass sie Depressionen haben könnte, kommt man erstmal nicht. Denn den wenigsten Menschen sieht man psychische Erkrankungen direkt an. Und doch musste Jasmin hart kämpfen, um heute hier zu sein. Nicht nur gegen ihre Depression. Sondern auch gegen eine erneute Krebserkrankung.
Auch wenn sich inzwischen einiges getan hat, was das Bewusstsein für psychische Erkrankungen angeht, auch Jasmin erlebt nach wie vor, dass für viele Menschen ihre Krebserkrankung leichter zu fassen ist. Trotzdem hat sich insgesamt etwas getan im öffentlichen Bewusstsein. Vielleicht auch, weil viele durch die Coronapandemie auch ohne psychische Erkrankung die Belastung wahrnehmen und an ihre Grenzen kommen.
„Gefühlt sind wir seit zweieinhalb Jahren in einem Schleudergang der Sch… drin, wo jeder feststellt: OK, da ist meine Grenze. Ich glaube auch Menschen, die nicht mit Depressionen oder ähnlichem diagnostiziert sind.“
Jasmin Faust
Viele Menschen erleben gerade Tage, an denen sie abends erschöpft auf der Couch sitzen und keine Kapazitäten mehr haben, um Nachrichten zu gucken. Das neue Bewusstsein für psychische Erkrankungen sei ein Zusammenspiel aus mehr Sichtbarkeit von Betroffenen und auch dem Erleben von eigenen Grenzen. Und dadurch entsteht mehr Verständnis für die jeweils andere Person.
LINKLISTE MIT HILFSANGEBOTEN:
Sobald in einer entsprechenden Situation unmittelbare Selbst- oder Fremdgefährdung (insbesondere Suizidgefährdung) besteht, sollte man nicht zögern, sofort einen psychiatrischen Notdienst, den Rettungsdienst (112) oder die Polizei zu verständigen.
- Nummern von Psychologischen Notdiensten in Deutschland, Österreich und der Schweiz
- Kontakt zum ärztlichen (psychiatrischen) Bereitschaftsdienst: bundesweite Telefonnummer 116 117 (kostenlos)
- Deutsche Depressionshilfe
- Kliniksuche der Deutschen Depressionshilfe
- Suche für Krisendienste und Beratungsstelle der Deutschen Depressionshilfe
- Depressions-Selbsttest nach WHO auf den Seiten der Robert-Enke-Stiftung
- Telefonseelsorge
Was wir gerade lernen: „It’s OK to be not OK.“ Und das ist mehr als nur ein Buzzword. Denn viele Menschen erkennen im Angesicht der eigenen Belastungsgrenze, dass sie nicht mehr so funktionieren, wie vor der Pandemie im Bezug auf ihre psychische Belastbarkeit. Dass wir nicht mehr so funktionieren können und wollen, wie wir das vielleicht von unseren Eltern und Großeltern noch gelernt haben.
„Ich glaube, dass auch viel Bewusstsein dadurch entsteht, dass mittlerweile fast jeder jemanden kennt.“
Jasmin Faust
Das Verlernen dieser „Stell dich nicht so an“-Sozialisation ist gar nicht so leicht. Das erleben zum Beispiel gerade auch viele Menschen, die mit den Folgen einer Covid-Erkrankungen leben. Sie erleben, dass ihr Körper nicht mehr so belastbar ist wie früher, dass die Konzentrations- und Merkfähigkeit gesunken ist. Und das sind nur die harmloseren Auswirkungen. Bei einigen sind das vorübergehende Folgen. Andere werden möglicherweise dauerhaft Einschränkungen haben. Die größte Herausforderung dabei ist es, diese Veränderung erst einmal zu akzeptieren. Und das ist gar nicht so einfach.
Über psychische Probleme sprechen
Wichtig ist aber, dass darüber gesprochen wird. Sei es in Sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #notjustsad oder auch einfach so im Freundeskreis und auf der Arbeit. Dieser Austausch führt nicht nur dazu, dass psychische Erkrankungen enttabuisiert werden. Sondern auch zu mehr Austausch unter den Betroffenen selbst. Dadurch entsteht eine neue Sprechfähigkeit und im Zuge dessen eben auch eine Form von Selbstermächtigung. Die ist auch wichtig im Hinblick auf verschiedene Therapien. Denn nur so können Betroffene ihre Bedürfnisse und Erfahrungen auch gegenüber Therapeut:innen
Jasmin zum Beispiel hat viele Jahre Medikamente genommen, darüber haben wir auch in der ersten Folge zum Thema ausführlicher gesprochen. Kurz nach unserem Gespräch konnte sie beginnen, die Medikamente abzusetzen. Aber nicht auf eigene Faust, sondern im ständigen Austausch mit ihrem behandelnden Therapeuten. Denn die Wirkung, sagt Jasmin, passiert im Kopf. Und ja, Psychopharmaka zu nehmen bedeutet auch, dass es zu starken Nebenwirkungen kommt. Jasmin war damals einfach an einem Punkt, an dem sie festgestellt hat: Ich brauche sie nicht mehr zur Unterstützung meines Heilungsprozesses. Es war der Punkt, an dem sie sich unter einer Art Glocke gefühlt hat. An dem sie wieder fähig war zu positiven Emotionen, Freude und Glück, diese Gefühle aber auch durch die Medikamente gedämpft wurden.
„Wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der sagt: Ich will die Medikamente nicht mehr nehmen, ich nehm die jetzt einfach nicht mehr … das ist wirklich das Dümmste, was du machen kannst.“
Jasmin Faust
Sie erzählt von einem Konzert, auf das sie sich richtig gefreut hat. Bei dem sie dabei sein, tanzen und die Musik genießen wollte. Aber diese Gefühle kamen nicht durch. Stattdessen hat sie das Konzert im Prinzip wohlwollend zur Kenntnis genommen. Aber diese totale Eintauchen und dabei sein, mittanzen wollen, das hat sie nicht fühlen können durch die Medikamente. Und das hat sie am Ende traurig gemacht.
„Ich hab gemerkt, dass die Medikamente mich auf einem ganz guten Level gehalten haben, was mir in schlechten Zeiten den Hintern gerettet hat. In guten Zeiten war es aber so, dass ich festgestellt hab: Es gibt keinen Aussschlag nach unten, aber es gibt auch keinen nach oben.“
Jasmin Faust
Sie spricht mit ihrem Psychiater über diese Erfahrung und sie entscheiden gemeinsam, die Medikamente auszuschleichen. Das heißt, die Dosierung wird langsam reduziert und Jasmin darf herausfinden, wie sie damit zurecht kommt. Denn, sagt Jasmin, wenn man mit der Dosierung runtergeht, merkt man schon, was das im Kopf macht. „Fahrradfahren in Köln war dann doch nochmal eine Spur herausfordernder, wenn du plötzlich ein bisschen Schwindel kriegst dabei.“ Sie stellt auch fest, dass sie in der Zeit häufiger stolpert. Aber das wurde mit der Zeit immer besser und irgendwann kann sie ganz aufhören, die Medikamente zu nehmen.
Leben mit Depressionen und Angststörungen
Im Moment ist Jasmin stabil. Aber sie weiß auch: Mit der Diagnose rezidivierende also wiederkehrende Depression ist das möglicherweise kein Dauerzustand. Zusätzlich besteht die Diagnose einer generalisierten Angststörung. Und auch die taucht immer mal wieder auf. Das sind dann Tage, an denen Jasmin beim Einkaufen eine Panikattacke überrascht. Für diesen Fall hat sie Bedarfsmedikamente verschrieben bekommen. Die kann sie einnehmen, wenn sie akut medikamentöse Unterstützung benötigt, um mit einer Situation zurecht zu kommen.
„Es ist gerade mal zwei Wochen her, dass ich gemerkt habe: Es wird alles wieder ein bisschen eng. Ich steuer da auf was zu, was sich nicht schön anfühlt.“
Jasmin Faust
Diese Bedarfsmedikamente sedieren die Betroffenen so, dass sie die Angst zwar immer noch wahrnehmen, aber sie wird ihnen egal. So gelingt es dann, die Atmung wieder zu beruhigen und die Situation auch verlassen zu können. Bei Jasmin wirken die Medikamente aber auch so, dass sie dann für den Rest des Tages ausgeknockt ist. Der Vorteil an den Bedarfsmedikamenten ist: Es muss nicht erst – wie bei anderen Antidepressiva und Psychopharmaka – über einen längeren Zeitraum ein Blutspiegel aufgebaut werden. Das heißt, das Medikament muss sich nicht im Blut anreichern, um zuverlässig zu wirken. Die Bedarfsmedikamente wirken fast sofort. Wichtig zu wissen ist, dass es dabei unterschiedliche Medikamente gibt in Bezug auf die Abhängigkeitswirkung. Das Bedarfsmedikament, das Jasmin verschrieben wurde, kann sie selbst dosieren und hat keine Abhängigkeitswirkung. Das ist übrigens kein Hinweis darauf, bestimmte Medikamente nicht zu nehmen. Aber es zeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Therapeut:innen ist an der Stelle.
Selbstbestimmung ist wichtig
Was für Betroffene, nicht nur im Bezug auf die eigene Therapie, wichtig ist: Auch Menschen mit Depressionen haben ein Recht auf Selbstbestimmung. Das ist vor allem für alle jene wichtig, die helfen wollen und es „nur gut meinen“. Betroffene haben ein Recht, gute Ratschläge zurückzuweisen. Und zwar ohne, dass sie erneut unter Druck geraten, weil ihr Gegenüber enttäuscht ist. Das ist ein schmaler Grat. Aber auch das nähere Umfeld muss sich fragen: Warum will ich hier helfen? Was kann ich tun und was nicht? Was wünscht sich die Betroffene Person jetzt gerade? Denn klar, es besteht immer der Wunsch, dass es der anderen Person besser geht. Das darf aber nicht davon abhängig gemacht werden, ob meine persönlichen Erwartungen erfüllt werden. Dazu ist eine Frage entscheidend: Bei wem bin ich, wenn ich helfen will. Geht es um meine eigenen Gefühle oder geht es wirklich um die Gefühle der betroffenen Person.
„Dazu gehört, dass man erstmal zuhört. Und zwar ohne zu werten. Wir neigen ja dazu, dass wir immer unsere eigene Ansicht oder unsere eigene Bewertung in ein Gespräch mit reinbringen.“
Jasmin Faust
So ging es Jasmin auch als sie erzählt hat, dass sie die Medikamente absetzen wird. Neben Fragen, warum sie das macht, wurde sie auch mit der Meinung konfrontiert, dass ihre Entscheidung schlicht falsch sei. Das ist so übergriffig wie verantwortungslos. Auch wenn es in Sorge um Jasmin und vermeintlich guter Absicht geäußert wurde. Trotzdem bleibt es Jasmins Entscheidung und auch ihr Risiko, das sie sorgfältig abgewägt hat eben auch in Abstimmung mit ihrem Therapeuten.
Hinzu kommt noch eine weitere Komponente. Denn natürlich wissen Betroffene, dass sie ihrem Umfeld Sorge bereiten. Und das erzeugt zusätzlichen Druck. Denn dann haben Betroffene nicht nur das Gefühl, sich um sich selber kümmern zu müssen, sondern auch noch die Sorgen ihres Umfelds mit berücksichtigen zu müssen. Im schlimmsten Fall endet das in einem Teufelskreis eigener Abwertung und das ist nicht hilfreich.
„Wenn du in einer Position bist, dass du erkrankt bist, ist natürlich ein belastender Aspekt, dass man sich selber als das Sorgenkind empfindet.“
Jasmin Faust
Denn: Niemand möchte das Sorgenkind sein. Und Jasmin war nicht nur durch ihre Depression bereits mehrfach in ihrem Leben auf die Hilfe ihres Umfelds angewiesen. Sie hat bereits zwei Krebserkrankungen und zwei Chemotherapien hinter sich. Gerade während der Chemotherapie erleben Krebserkrankte häufig, wie ihr Körper alltäglichen Belastungen nicht mehr Stand hält. Und obwohl sie von ihrer ersten Krebserkrankung bereits wusste, wie heftig die Nebenwirkungen der Chemotherapie sind, ist es für Jasmin zunächst unglaublich schwer, um Hilfe zu bitten. Deshalb bewältigt sie die ersten beiden Sitzungen alleine, geht zu Fuß zur Chemotherapie und zu Fuß auch wieder nach Hause. Einfach, weil sie kein Sorgenkind sein will. Weil sie nicht will, dass jemand Zeit für sie aufwendet, die er vielleicht grade gar nicht hat.
„Es war eine absolute Scheißidee zu Fuß von der Chemo nach Hause zu gehen.“
Jasmin Faust
Ein guter Freund bietet ihr dann für die dritte Sitzung, sie nach Hause zu fahren. Selbst da verspürt Jasmin noch einen inneren Widerstand, weil Hilfe annehmen zu müssen einfach auch heißt, dass man hilfsbedürftig ist. Und dass Jasmin am Ende doch diese Hilfe annimmt, hat nicht unerheblich damit zu tun, dass sie on top Lungenembolien entwickelt. Also ihr Körper einfach sagt: Sorry, aber geht nicht mehr ohne Hilfe.
Hilfe muss auf Augenhöhe stattfinden
Das erleben zu müssen, ist nicht schön. Und trotzdem ist Jasmin den Menschen um sie rum sehr dankbar dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben. Dass sie da waren, als sie selbst nicht mehr konnte. Und trotzdem bleibt das Gefühl, als Sorgenkind irgendwie kleiner zu sein als die Menschen um einen herum, die in der Lage sind Hilfe zu leisten. Und deswegen ist Jasmins eindringlicher Wunsch: Hört hilfsbedürftigen Menschen zu. Bleibt auf Augenhöhe. Nehmt sie ernst.
„Es ist wichtig, die Hilfe anzubieten und sie nicht überzustülpen“
Jasmin Faust
Und vor allem: Bleibt bei euch. Denn so gerne wir helfen möchten, manchmal sieht Hilfe ganz anders aus als das, was wir uns darunter vorstellen. Denn nicht immer kann Hilfe Situationen verbessern. Es gibt nämlich Situationen, die sind einfach nicht gut. Und die werden auch trotz aller Hilfe nicht besser. Zum Beispiel, wenn jemand in einer depressiven Episode ist, wenn jemand eine schwere Diagnose erhalten hat oder auch, wenn jemand trauert, weil er einen lieben Menschen verloren hat, wenn jemand einen Job verloren hat oder das eigene Leben zusammenbricht.
All das sind Situationen auf die Helfende akut keinen Einfluss haben. Es gibt nichts, was sie sagen können, um die Situation zu verbessern, die Traurigkeit, die Ängste, die Wut zu nehmen. Und ja, das sind keine schönen Situationen. Sehr häufig lösen sie beim Gegenüber Sprachlosigkeit aus. Und Hilflosigkeit. Und um dieser Hilflosigkeit irgendetwas entgegen zu setzen, greifen wir dann zu Sätzen wie: „Das wird wieder besser werden.“ Auch wenn wir das gar nicht versprechen können. Damit hat sich aber de facto in der Situation noch nichts verbessert. Und die Lösung liegt für alle in der vagen Hoffnung auf einer entfernte Zukunft. Eine Situation, die für alle Beteiligten schwer auszuhalten ist.
In Notsituationen: Essen, Trinken, Warmhalten
Auf das Naheliegendste, sagt Jasmin, kommen die meisten Menschen gar nicht. Das seien ganz basale Dinge. Wie zum Beispiel dafür Sorge zu tragen, dass die Person isst und trinkt. Dass sie es warm hat. Das sind die ersten Dinge, die von Personen in Extremsituationen hinten an gestellt werden. Und wer helfen möchte, kann sich vor allem erst einmal darum kümmern. Das klingt banal. Aber Extremsituationen sind kräftezehrend. Und um da raus zu kommen, brauchen wir Energie. Und wenn sich Helfende darum kümmern, ist das viel mehr als gute Worte im akuten Fall bewirken können. Und dann sind wir auch nicht mehr bei uns selbst und unserem Unwohlsein, sondern wirklich bei der anderen Person.
„Eigentlich ist in dem Moment das Wichtigste, vielleicht im entscheidenden Moment die Schnauze zu halten und zu signalisieren, dass man da ist.“
Jasmin Faust
Was wir auch tun können, ist im Gespräch bleiben. Fragen stellen. Um herauszufinden, wie es der anderen Person geht. Auch wenn wir glauben, die Antwort schon zu wissen. Auch dann, wenn sich vermeintlich „nichts Neues“ aus den Gesprächen ergibt oder die Antworten unbefriedigend sind. Denn es geht zunächst darum, in Kontakt zu bleiben, eine Verbindung zu haben oder überhaupt erst zu etablieren. Und dabei ist es wichtig, dass wir nicht nur genau zuhören, sondern auch Abstand nehmen von unseren eigenen Bewertungen.
Das heißt konkret: Wer helfen will, muss loslassen können und aushalten. Loslassen von den eigenen Erwartungen, davon, dass sich die Situation schnell verbessert oder man selbst der- oder diejenige ist, die alles besser machen kann. Und aushalten, dass das eben so ist. Dass die Situation akut einfach nicht gut ist. Und das klingt wesentlich leichter als es sich hier so hin schreibt.
Der Weg zu radikaler Akzeptanz
Für Jasmin war der Weg zu einem „Besser“ einer, der sie erst einmal noch tiefer in den Schmerz geführt hat. Denn um wirklich zu heilen, musste sie sich mit ihren Traumata beschäftigen. Manche der Erlebnisse hat sie so sehr von sich abgespalten, dass sie an die Erinnerung heute nicht mehr ran kommt. An andere Ereignisse konnte sie sich im Rahmen der Traumatherapie aber erinnern und war so wieder mit ihrem Schmerz konfrontiert. Heute sagt sie, die Traumatherapie war das härteste, was sie in ihrem Leben gemacht hat.
„Die Traumatherapie war mit eine der härtesten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe. Es war viel, viel härter als das, was mein Körper während einer Chemotherapie aushalten musste.“
Jasmin Faust
Und am Ende dieses Weges stand das, was man „radikale Akzeptanz“ nennt. Und vielleicht erinnern sich diejenigen, die das erste Gespräch gehört haben, dass Jasmin da noch nicht angekommen war damals. „Radikale Akzeptanz“ bedeutet, anzunehmen und zu akzeptieren, dass sie traumatisierenden Dinge, die sie erlebt hat, nicht verändern kann. Dass sie weder die physische und psychische Gewalt rückgängig machen kann, die sie in ihrer Vergangenheit erlebt hat, noch Einfluss darauf hat, ob ihr sowas in Zukunft nochmal passiert. Sie kann eigentlich nur im Jetzt bleiben. Den Moment kann sie für sich bewerten und auch gestalten. Radikale Akzeptanz heißt, dass man das, was einem passiert ist, auch wirklich so annimmt. Und auch nicht weiter hinterfragt. Dazu hat Jasmin auch einen ausführlichen Blogartikel verfasst auf „How to get lost„, den ich euch hiermit sehr ans Herz legen möchte.
„Ich kann dir bis jetzt nicht sagen, wie ich an diesen Punkt gekommen bin, dass ich sage, das ist OK. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich kann dir kein Rezept dafür geben.“
Jasmin Faust
Am Ende war es eine ständige Übung. Zu lernen, dass diese Dinge nicht veränderbar sind. Und nicht vorhersagbar. Am Ende dieser Übung hat Jasmin Ruhe gefunden sagt sie. Und es hat zur temporären Heilung beigetragen. Jasmin sagt bewusst temporär. Denn obwohl sie eine schon recht lang anhaltende stabile Phase erlebt, ist sie einfach nicht sicher ist, ob da nochmal was kommt. Aber – und das ist der Unterschied zu unserem ersten Gespräch vor zweieinhalb Jahren:
„Der Unterschied zu unserem letzten Gespräch ist, das sich heute sage: OK, und wenn es kommt, dann ist es halt so. Dann akzeptiere ich das für mich. Weil ich in der Zwischenzeit gelernt habe, dass diese Zustände nicht bei bleiben.“
Jasmin Faust
Heute hat Jasmin Rüstzeug. Techniken, von denen sie weiß, dass sie ihr helfen, sich wieder zu stabilisieren. Für den Moment geht es Jasmin erstmal so gut, dass sie kürzlich ihre letzte Therapiestunde hatte.
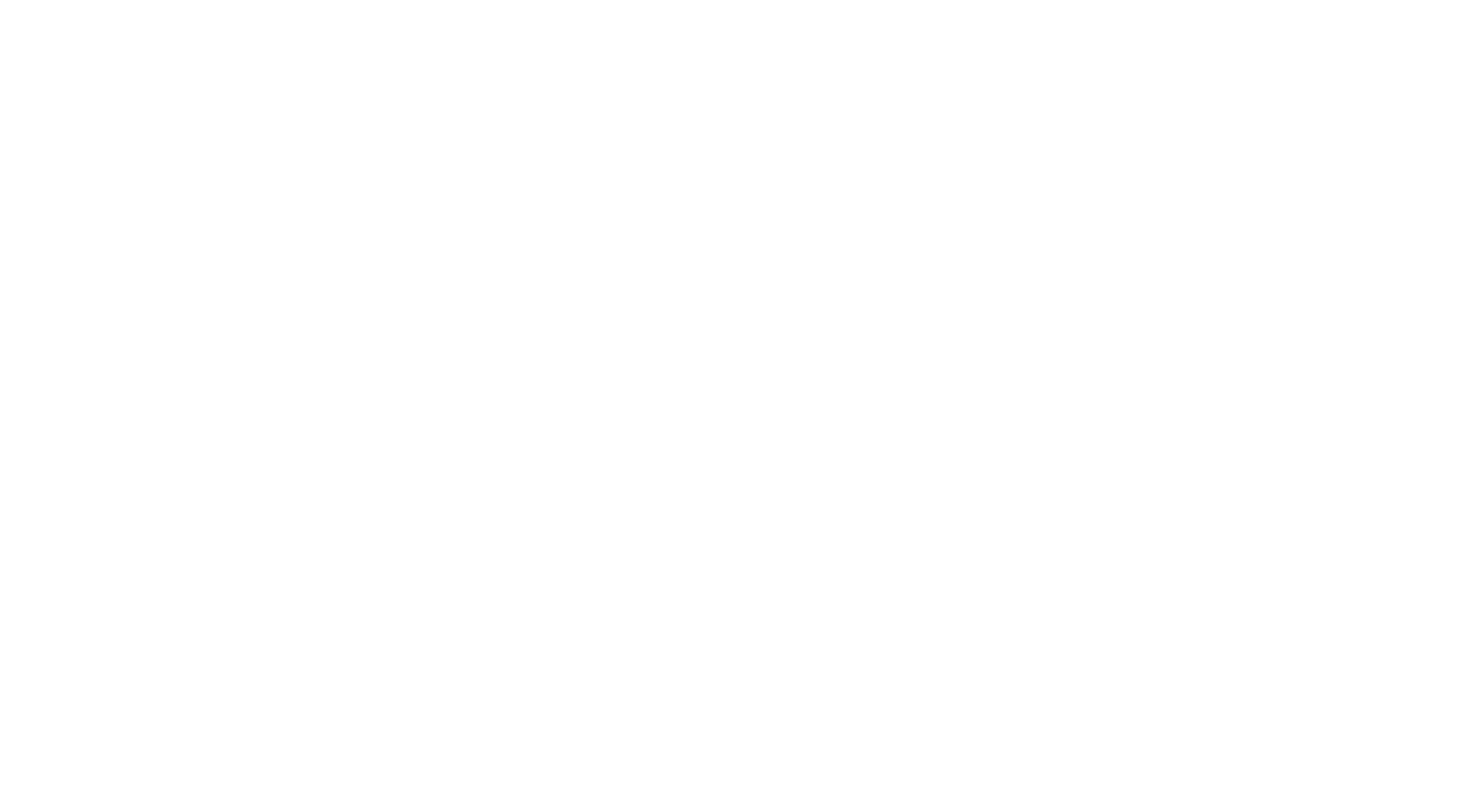








Ralf Razborsek
3. November 2023 — 13:01
Vielen Dank für diesen wirklich wichtigen Beitrag. Ich werde ihn gern in meinem sozialen Umfeld teilen.
Herzliche Grüße vom Niederrhein <3
Frau Nora
3. November 2023 — 16:57
Vielen Dank für die Wertschätzung. Und auch fürs Teilen. Ich habe selbst von meiner Freundin Jasmin viel gelernt. Und ich finde es schön, dass es anderen genauso geht. 🙂